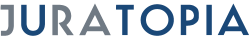In diesem Artikel zeige ich:
- ein Prüfungschema zur Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2 StGB bei getrennter Prüfung der Tatbeteiligten,
- eine Zusammenfassung zur Mittäterschaft mit den wichtigsten Erklärungen und Klausurproblemen und
- ein Prüfungsschema zur Mittäterschaft bei gemeinsamer Prüfung der Beteiligten.
Getrennte oder gemeinsame Prüfung zweier Mittäter?
- Prüfe zwei Beteiligte getrennt, wenn einer alle Tatbestandsmerkmale selbst unmittelbar verwirklicht hat, der andere hingegen nicht. Bei dem zweiten Beteiligten brauchst du dann die Zurechnung des § 25 II StGB.
- Prüfe zwei Beteiligte gemeinsam, wenn a) beide gleich handeln oder b) beide einen Tatbestand nur verwirklichen, wenn man die Handlungen gegenseitig zurechnet (teils als additive Mittäterschaft bezeichnet).
Prüfungsschema zur Mittäterschaft: Getrennte Prüfung
A. Strafbarkeit des Tatnächsten
B. Strafbarkeit des Mittäters
I. Tatbestand
1. Objektiver Tatbestand
a) Deliktsspezifische objektive Merkmale, für deren Erfüllung keine Zurechnung der Handlungen des Tatnächsten erforderlich ist
b) Tathandlungen, die der Mittäter nicht selbst verwirklicht hat, sondern ihm über 25 II StGB zugerechnet werden müssen
aa) Gemeinsamer Tatplan
bb) Gemeinschaftliche Begehung
i) Eigener Verursachungsbeitrag
ii) Abgrenzung zur Teilnahme / Täterschaftliche Gleichrangigkeit
2. Subjektiver Tatbestand
a) Vorsatz bezüglich aller objektiven deliktsspezifischen Tatbestandsmerkmale
b) Vorsatz bezüglich der gemeinschaftlichen Begehung
c) Ggf. Tatherrschaftsbewusstsein (nach der Tatherrschaftslehre)
d) Ggf. besondere subjektive Merkmale
3. Ggf. Tatbestandsverschiebung nach § 28 II StGB
II. Rechtswidrigkeit
III. Schuld
Zusammenfassung zur Mittäterschaft: Getrennte Prüfung
A. Strafbarkeit des Tatnächsten
Normale Prüfung des jeweiligen Straftatbestandes wie beim Alleintäter.
Mittäterschaft oder § 25 Abs. 2 StGB musst du hier gar nicht erwähnen, weil der Tatnächste alle tatbestandsrelevanten Handlungen selbst verwirklicht. Eine mittäterschaftliche Zurechnung ist nicht erforderlich.
B. Strafbarkeit des Mittäters
I. Tatbestand
1. Objektiver Tatbestand
a) Deliktsspezifische objektive Merkmale, für deren Erfüllung keine Zurechnung der Handlungen des Tatnächsten erforderlich ist
b) Tathandlungen, die der Mittäter nicht selbst verwirklicht hat, sondern ihm über 25 II StGB zugerechnet werden müssen
Eine Zurechnung der Tatbeiträge anderer Täter erfolgt, wenn die Täter auf Grund eines gemeinsamen Tatplans tätig wurden und die Tat gemeinschaftlich begangen haben.
aa) Gemeinsamer Tatplan
Ein gemeinsamer Tatplan ist ein ausdrückliches oder konkludentes1 Einvernehmen, gemeinsam ein deliktisches Ziel zu verfolgen.2
Der gemeinsame Tatplan kann auch erst während der Tat gefasst werden. (Beispiel: die Geschäftsführung eines Unternehmens entscheidet, von einem Rückruf gefährlicher Produkte abzusehen. Erst anschließend schließen sich Geschäftsführer weiterer Unternehmen dem an.)3
Die Mittäter müssen sich persönlich nicht kennen.4
Eine Mittäterschaft ohne jegliche Verständigung ist jedoch nicht möglich.5
Klausurproblem: Ausstieg vor Versuchsbeginn
Umstritten ist, ob Mittäter sein kann, wer sich noch vor Versuchsbeginn vom gemeinsamen Tatplan distanziert.
- herrschende Meinung: Eine Distanzierung vom Tatplan steht einer Mittäterschaft jedenfalls dann nicht im Wege, wenn die im Vorbereitungsstadium geleisteten Tatbeiträge (einschließlich psychischer Tatbeiträge) dennoch fortwirken.6
- Mindermeinung: Wir sich vor dem Ansetzen zur Tatbestandsverwirklichung vom Tatplan lossagt, ist nicht Mittäter. Argument: Es fehle dann an der (funktionellen) Tatherrschaft.7
Klausurproblem: Fahrlässige Mittäterschaft
Ob eine fahrlässige Mittäterschaft möglich ist, ist umstritten. Relevant wird die Frage, wenn nicht nachweisbar ist, wer von mehreren fahrlässig Handelnden für den Deliktserfolg kausal geworden ist und deshalb eine gegenseitige Zurechnung der Handlungen nach § 25 Abs. 2 StGB erforderlich wäre.
- Nach einer Mindermeinung ist eine fahrlässige Mittäterschaft möglich, wenn ein gemeinsamer Tatplan alle Beteiligten als gleichberechtigte Partner eines gemeinsamen Handlungsprojekts ausweist, welches sich als Setzung einer unerlaubten Gefahr darstellt.8
- Nach herrschender Meinung ist eine fahrlässige Mittäterschaft nach § 25 Abs. 2 StGB nicht möglich, da es am gemeinsamen Tatplan fehle.9 Nach der h.M. muss sich der Tatplan auf einen deliktischen Erfolg richten, was bei Fahrlässigkeit jedoch nicht möglich ist.10
Mehr zum Meinungsstreit um die fahrlässige Mittäterschaft.
Klausurproblem: Mittäterschaft bei Gremien- und Kollegialentscheidungen
Ebenfalls umstritten ist die mittäterschaftliche Zurechnung bei Gremien- und Kollegialentscheidungen. Mehr dazu hier.
bb) Gemeinschaftliche Begehung
i) Eigener Verursachungsbeitrag
Klausurproblem: Tätigwerden nur im Vorbereitungsstadium
Umstritten ist, ob ein eigener Verursachungsbeitrag zu bejahen ist, wenn ein Beteiligter im Ausführungsstadium selbst nicht mitwirkt, sondern lediglich im Vorbereitungsstadium.
- Nach dem BGH können auch Handlungsbeiträge im Vorbereitungsstadium eine Mittäterschaft begründen.11 Diese Ansicht ist vor dem Hintergrund der subjektiv geprägten Abgrenzung des BGH zwischen Täterschaft und Teilnahme zu verstehen (dazu unten mehr): Solange der Beteiligte die Tat als eigene wolle, kann er nach Verständnis des BGH in einer Gesamtabwägung auch Mittäter sein, ohne im Ausführungsstadium gehandelt zu haben.12
- Nach der herrschenden Lehre hingegen muss ein “Weniger” bei der Ausführung durch ein “Mehr” bei der Planung ausgeglichen werden (sog. funktionale Tatherrschaft).13 Diese Ansicht fußt auf einem eher weiten Verständnis der Tatherrschaftslehre: Wer ein Mehr bei der Planung leistet, kann den tatbestandlichen Geschehensablauf trotz eines „Weniger“ in der Tatausführung noch „in den Händen halten“. (Wie gesagt, die Tatherrschaftslehre und die anderen Methoden der Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme erkläre ich weiter unten noch genauer.)
- Nach einer Minderansicht in der Literatur fehlt es ohne ein Tätigwerden im Ausführungsstadium am eigenen Verursachungsbeitrag, so dass eine gemeinschaftliche Begehung ausscheidet.14 Dahinter steht ein strenges Verständnis der Tatherrschaftslehre: Wer im Ausführungsstadium nicht mitwirkt, halte den tatbestandlichen Geschehensablauf nicht in den Händen.
Mehr zur Mittäterschaft bei Tätigwerden nur im Vorbereitungsstadium.
Klausurproblem: sukzessive Mittäterschaft
- Nach dem BGH können auch Handlungsbeiträge zwischen Vollendung und Beendigung einer Tat eine Mittäterschaft begründen, sofern sie die Tat fördern.15 (Beispiel: Mittäterschaft bei einem Schmuggel nach § 373 AO ist möglich, bis das „geschmuggelte Gut in Sicherheit gebracht und zur Ruhe gekommen“ ist.16)
- Nach h.L. können Beitragshandlungen nach Vollendung keine Mittäterschaft begründen.17 Argument: Zwischen Vollendung und Beendigung wird das tatbestandliche Unrecht nicht mehr „begangen“, daher liegt keine gemeinschaftliche „Begehung“ gemäß § 25 Abs. 2 StGB vor.
Die unterschiedlichen Ansichten von Rechtsprechung und herrschender Lehre sind auch hier im Zusammenhang mit dem Streit um die Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme zu sehen: Stellt man objektiv streng auf das „in den Händen Halten des tatbestandlichen Geschehensablaufs“ ab, kommt man zu dem Ergebnis, dass eine Beitragshandlung nach Vollendung gerade nicht mehr zum tatbestandlichen Geschehensablauf gehört.
Nimmt man mit der Rechtsprechung hingegen eine Gesamtabwägung unter Berücksichtigung auch subjektiver Faktoren vor, lässt sich eine Mittäterschaft durch „Förderung“ der Tat zwischen Vollendung und Beendigung leichter begründen.
Mehr zur sukzessiven Mittäterschaft.
Klausurproblem: Mittäterschaft durch Unterlassen
Bei einer Mittäterschaft durch Unterlassen gibt es ein paar Fallen. Problematisch ist eine mittäterschaftliche Zurechnung vor allem dann, wenn ein Unterlassender neben einem aktiv Handelnden unterlässt. Mehr dazu hier.
ii) Abgrenzung zur Teilnahme / Täterschaftliche Gleichrangigkeit
Der Tatbeitrag jedes Mittäters muss die Schwelle zur Täterschaft erreichen. Das heißt, du musst die Mittäterschaft von der bloßen Teilnahme abgrenzen. Wie das zu geschehen hat, ist hochumstritten:
- Nach der Tatherrschaftslehre der h.L. ist für eine Mittäterschaft das vom Vorsatz umfasste in den Händen Halten des tatbestandlichen Geschehensablaufs erforderlich.18
- Nach der subjektiven Theorie der früheren Rechtsprechung kommt es darauf an, ob der Täter die Tat als eigene wollte.19
- Die aktuelle Rechtsprechung vertritt eine normative Kombinationstheorie und grenzt nach einer Gesamtbetrachtung objektiver und subjektiver Faktoren ab.20 Relevante Kriterien sind danach insbesondere Art und Umfang der Tatbeteiligung, Wichtigkeit des Tatbeitrage, ein Eigeninteresse des Beteiligten, ob die Beteiligten sich eher gleichberechtigt oder in einem Über-Unterordnungsverhältnis zueinander befinden und die Beteiligung an der Beute.21
Selbst die frühere Rechtsprechung musste aber auch auf objektive Kriterien zurückgreifen, um zu beurteilen, ob der Täter die Tat als eigene wollte. Deshalb führen alle drei Theorien an dieser Stelle in der Klausur oft zum selben Ergebnis. Unterschiede ergeben sich vor allem mit Blick auf Handlungen im Vorbereitungsstadium und die sukzessive Mittäterschaft, dazu schon oben.
Mehr zur Abgrenzung von Täterschaft und Teilnahme.
2. Subjektiver Tatbestand
a) Vorsatz bezüglich aller objektiven deliktsspezifischen Tatbestandsmerkmale
b) Vorsatz bezüglich der gemeinschaftlichen Begehung
Klausurproblem: Mittäterexzess
Ein Exzess eines Mittäters, d.h. eine wesentliche Abweichung vom gemeinsamen Tatplan22, ist vom Vorsatz der anderen Mittäter nicht erfasst und ihnen deshalb nicht zuzurechnen. 23
Eine solche wesentliche Abweichung vom Tatplan und damit ein Exzess des Mittäters liegt jedoch nicht vor, wenn:
- mit der Abweichung nach den Umständen des Falles gerechnet werden muss,
- die verabredete Tatausführung durch eine in ihrer Schwere und Gefährlichkeit gleichwertige ersetzt wird oder
- dem Mittäter die Handlungsweise seines Tatgenossen in Bezug auf die Abweichung gleichgültig ist.24
Klausurproblem: Error in Persona durch Mittäter
Umstritten ist die Behandlung eines Error in Persona durch einen Mittäter.25
Beispiel: A und B vereinbaren, C zu töten. B hält den D für den C und erschießt ihn.
- Nach herrschender Meinung muss A sich die Tötung des D über § 25 Abs. 2 StGB als Mittäter zurechnen lassen (angenommen, die übrigen Voraussetzungen der Mittäterschaft liegen vor).
- Nach einer Mindermeinung handelt es sich um einen Mittäterexzess, den A sich nicht mittäterschaftlich zurechnen lassen muss.
Sonderfall: Beim Error in Persona ist der Verletzte kein Dritter, sondern selbst Tatbeteiligter.
- BGH: Mittäterschaft ist möglich. Im berüchtigten „Verfolgerfall“ war der auf der Flucht angeschossene Tatbeteiligte nur verletzt wurden, der BGH hat eine Strafbarkeit des Verletzten wegen mittäterschaftlichen versuchen Mordes an sich selbst bejaht (untauglicher Versuch, da untaugliches Tatobjekt).26
- Minderansicht: Eine starke Ansicht in der Literatur lehnt eine mittäterschaftliche Zurechnung ab, da der Getroffene als auf ihn geschossen wurde, die Tatherrschaft verloren habe.27
c) Ggf. Tatherrschaftsbewusstsein (nach der Tatherrschaftslehre)
Möglicherweise hast du das Wollen der Tat als eigene schon bei der Abhandlung der subjektiven Theorie oder der normativen Kombinationstheorie im objektiven Tatbestand bejaht. Sofern du der Tatherrschaftslehre gefolgt bist, musst du im subjektiven Tatbestand feststellen, dass der Vorsatz des Täters sich auch auf die objektiven Umstände, welche die Tatherrschaft begründen, bezieht.
d) Ggf. besondere subjektive Merkmale
Besondere subjektive Merkmale wie z.B. eine Bereicherungsabsicht müssen bei jedem Täter vorliegen und werden über § 25 Abs. 2 StGB ebenso wenig zugerechnet wie die anderen subjektiven Tatbestandsmerkmale.
3. Ggf. Tatbestandsverschiebung nach § 28 II StGB
II. Rechtswidrigkeit
Allgemeine Rechtfertigungsgründe
III. Schuld
Prüfungsschema zur Mittäterschaft: Gemeinsame Prüfung
A. Tatbestand
I. Objektiver Tatbestand
1. Deliktsspezifische objektive Merkmale, für deren Erfüllung keine Zurechnung der Handlungen des jeweils anderen erforderlich ist (Bsp: Fremdheit einer Sache)
2. Tathandlungen, die über 25 II StGB zugerechnet werden müssen
Hier ist deutlich zu beschreiben, wer welche Tathandlung begangen hat und welche Tathandlungen deshalb wem mittäterschaftlich zugerechnet werden müssen. Dann wird die mittäterschaftliche Zurechnung geprüft:
a) Gemeinsamer Tatplan
b) Gemeinschaftliche Begehung
aa) Eigener Verursachungsbeitrag jedes Mittäters
bb) Abgrenzung zur Teilnahme / Täterschaftliche Gleichrangigkeit jedes Mittäters
II. Subjektiver Tatbestand
1. Vorsatz jedes Mittäters bezüglich aller objektiven deliktsspezifischen Tatbestandsmerkmale
2. Vorsatz jedes Mittäters bezüglich der gemeinschaftlichen Begehung
3. Ggf. Tatherrschaftsbewusstsein jedes Mittäters (nach der Tatherrschaftslehre)
4. Ggf. besondere subjektive Merkmale jedes Mittäters
III. Ggf. Tatbestandsverschiebung nach § 28 II StGB
B. Rechtswidrigkeit
Für jeden Mittäter zu prüfen. Allgemeine Rechtfertigungsgründe.
C. Schuld
Für jeden Mittäter zu prüfen. Allgemeine Entschuldigungsgründe.
Schlusswort
Ich hoffe, Du fandest diese Übersicht zur Mittäterschaft nach § 25 II StGB hilfreich. Wenn Du Verbesserungsvorschläge hast, lass es mich gerne wissen! Ich bin immer bemüht, die Inhalte auf Juratopia weiter zu verbessern.
Übrigens habe ich auch einen kostenlosen E-Mail Kurs mit Lerntipps für Jurastudenten – basierend auf wissenschaftlicher Forschung zum effektiven Lernen. Du kannst Dich hier kostenlos anmelden.
Quellennachweise:
- BGH, Urteil vom 15.01.1991, Az.: 5 StR 492/90.
- BeckOK StGB, 50. Edition Stand 01.05.2021, § 25 Rn. 49.
- BGH, Urteil vom 06.07.1990, Az.: 2 StR 549/89.
- BGH, Urteil vom 12.11.2009, Az.: 4 StR 275/09; Schönke/Schröder StGB, 30. Auflage 2019, § 25 Rn. 72.
- BGH, Beschluss vom 18.05.1995, Az.: 5 StR 139/95.
- BGH, Urteil vom 13.03.1979, Az.: 1 StR 739/78; kritisch zum Ansatz der Rechtsprechung BeckOK StGB, 50. Edition Stand 01.05.2021, § 25 Rn. 51.
- so Lackner/Kühl StGB, 9. Auflage 2018, § 25 Rn. 10.
- Renzikowski, Die fahrlässige Mittäterschaft, ZIS 2/2021, 92, 97; weitere Nachweise bei Schönke/Schröder StGB, 30. Auflage 2019, Vorb. § 25 ff., Rn. 111.
- Lackner/Kühl StGB, 29. Auflage 2018, § 25 Rn. 13 mit weiteren Nachweisen.
- ausführlich zu diesem Einwand Renzikowski, Die fahrlässige Mittäterschaft, ZIS 2/2021, 92, 98.
- BGH, Beschluss vom 29.09.2015, 3 StR 336/15.
- BGH, Beschluss vom 29.09.2015, 3 StR 336/15.
- im Detail zum Meinungsspektrum in der Literatur MüKo StGB, 4. Auflage 2020, § 25 Rn. 198.
- zusammenfassend zu dieser Ansicht mit weiteren Nachweisen MüKo StGB, 4. Auflage 2020, § 25 Rn. 198.
- BGH, Beschluss vom 10.06.1997, Az.: 1 StR 236/97; BGH, Beschluss vom 29.4.1998, Az.: 2 StR 664/97; BGH, Beschluss vom 18.07.2000, Az.: 5 StR 245/00.
- BGH, Beschluss vom 18.07.2000, Az.: 5 StR 245/00.
- MüKo StGB, 4. Auflage 2020 § 25 Rn. 211.
- ausführlich zur Tatherrschaftslehre und ihren Schattierungen mit vielen Nachweisen Schönke/Schröder StGB, 30. Auflage 2019, Vorb. § 25, ff. Rn. 57 ff.
- etwa BGH, Urteil vom 5. 5. 1954 Az.: 1 StR 626/53.
- etwa BGH, Beschluss vom 29. 1. 2009, Az.: 3 StR 540/08.
- BGH, Beschluss vom 29. September 2015, Az.: 3 StR 336/15; BGH, Beschluss vom 19.11.2019, Az.: 4 StR 449/19.
- BGH, Urteil vom 14.12.2016, Az.: 2 StR 177/16.
- MüKo StGB, 4. Auflage 2020, § 25 Rn. 239.
- BGH, Urteil vom 14.12.2016, Az.: 2 StR 177/16.
- Zusammenfassend MüKo StGB, 4. Auflage 2020, § 25 Rn. 245 f.
- BGH, Urteil vom 23.01.1958, Az.: 4 StR 613/57.
- dazu Seher, Grundfälle zur Mittäterschaft, JuS 2009, 304, 306.